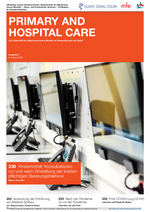Swiss Health Web
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
+41 (0)61 467 85 44
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealtweb.ch
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz
+41 (0)61 467 85 44
support@swisshealthweb.ch
www.swisshealtweb.ch
Der SGAIM Frühjahrskongress 2024 findet in Basel statt.


Die Facharztprüfung Allgemeine Innere Medizin (AIM) geht mit der Zeit: Ab 2026 wird die Prüfung nicht mehr auf Papier, sondern auf elektronischen Tablets geschrieben. Bereits ab 2025 finden die Facharztprüfungen zweimal jährlich neu zentral in Bern statt, und zwar im Hochschulzentrum VonRoll der Universität Bern. Dies hat die Facharztprüfungskommission initiiert.

Diese Fortbildung unter der Ägide des Kollegiums für Hausarztmedizin richtet sich an alle Grundversorgende. Und zwar ebenso an solche, die schon Kinder betreuen, aber mehr Sicherheit in der pädiatrischen Vorsorge gewinnen möchten, wie auch an Interessierte, die bisher noch wenig Erfahrung damit hatten. Entwicklungspädiaterinnen und Entwicklungspädiater mit Erfahrung und Begeisterung im Teaching haben ein spannendes Programm ausgearbeitet.


Nun, was kann man gegen diese chronische Rhinitis tun? Die Bluttests haben zwar eine Allergie gegen Staub und Gräser ergeben, aber in dieser Wohnung ist alles tadellos. Selbst mit einer Lupe wäre kein Staubkorn erkennbar. Der frisch gewachste Parkettboden ist glatt wie eine Eisbahn und ich kann verstehen, dass Louis Angst hat, aufzustehen und hinzufallen. Sogar ich gehe mit kleinen Schritten um nicht auszurutschen.

Als Vorstandsmitglied der SGAIM und praktizierende Hausärztin in den Bündner Bergen werde ich oft gefragt: «Was macht die SGAIM eigentlich für uns Hausärztinnen und Hausärzte?» Grundsätzlich liegt es mir sehr am Herzen, dass sich die Fachgesellschaft für uns Grundversorgerinnen und Grundversorger in der Praxis einsetzt und unsere Interessen vertritt. Deshalb ist das Co-Präsidium der SGAIM mit einer Hausärztin bzw. einem Hausarzt und einer Spitalärztin bzw. einem Spitalarzt besetzt. Auch in den verschiedenen Kommissionen sind die beiden Bereiche ausgewogen vertreten. Dadurch ist gewährleistet, dass die Hausarztmedizin und die Spitalmedizin zu gleichen Teilen repräsentiert sind und ein Austausch zwischen den beiden Tätigkeitsfeldern möglich ist.


Die fünf Verbände SGAIM, pädiatrie schweiz, Kinderärzte Schweiz, mfe und palliative.ch bejahen den Grundsatz, dass Palliativpatientinnen und -patienten regional und in einem interprofessionellen Setting betreut werden. Sie setzen sich dafür ein, dass unter ihren Mitgliedern die Standards und Tools der Palliative Care (wie Rundtischgespräche, Betreuungsplan, Advanced Care Planning und Assessement wie beispielweise nach dem SENS-Modell [1]) bekannt sind und der erhöhte Arbeitsaufwand, der gerade auch in der Kindermedizin über den Tod hinaus geht (Nachbetreuung), adäquat entgolten wird.